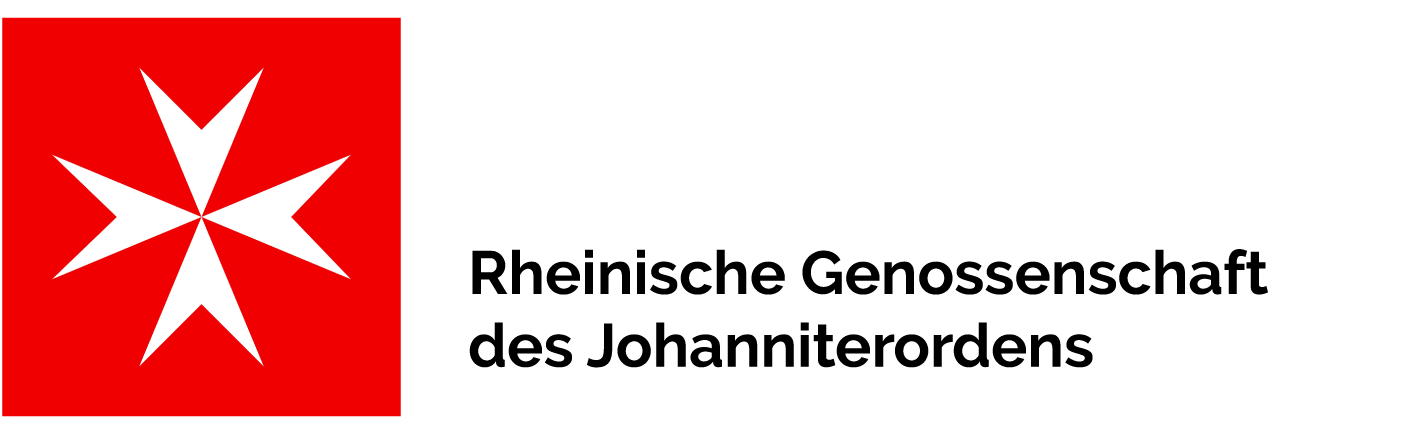Johanniterorden
Anfänge
Die Geschichte des Johanniterordens beginnt vor mehr als 900 Jahren. Während des Ersten Kreuzzuges erobert ein christliches Ritterheer 1099 Jerusalem. Dort finden sie ein dem Heiligen Johannes, auch „der Täufer“ genannt, geweihtes Hospital vor, in dem unter Leitung von Meister Gerhard eine Laienbruderschaft kranke und schwache Pilger pflegt. Beeindruckt von deren Arbeit schließen sich in der Folge viele Ritter dieser Gemeinschaft an.
1113 erhält sie durch Papst Pascalis II. die Anerkennung als selbständige Gemeinschaft. Bemerkenswert ist, dass bereits seit diesen frühen Anfängen auch Ordensschwestern ihren Dienst im Hospital versahen. Aufgrund ihres ursprünglichen Wirkungsortes werden sie fortan „Hospitaliter“ bzw. „Johanniter“ genannt. Damit beginnt die eigentliche Geschichte des Ordens.
Ein Doppelauftrag, der bis heute verpflichtet
Bis 1180 entwickelt sich der Hospitalorden zu einem geistlichen Ritterorden mit dem Doppelauftrag, sich im „Kampf dem Unglauben“ zu beweisen und seinen „Dienst am Herren Kranken“ zu leisten. Zentrales Element seiner Ausrichtung ist dabei das „Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe“ (Matthäus 22, 37 und 39):
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.[…] Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Sein Zeichen wird das achtspitzige Kreuz, das auf die Seligpreisungen der Bergpredigt (Matthäus 5, 3-10) verweist. Neben der Versorgung der Kranken und Bedürftigen entsteht mehr und mehr die Notwendigkeit, dass die Johanniter auch zum militärischen Schutz der Pilgerwege und der heiligen Stätten eingesetzt werden.
Nach dem Verlust des Heiligen Landes 1291 kämpft der Orden von Zypern, Rhodos und schließlich von Malta aus weiter gegen die Osmanen und ihre Expansion Richtung Westen. Mit der Besetzung Maltas und der Vertreibung des Ordens 1798 durch Napoleon Bonaparte tritt der militärische Auftrag des Ordens in den Hintergrund. Das aktive Eintreten für den christlichen Glauben ist aber nach wie vor eine der zwei elementaren Säulen der Ordensausrichtung.
Bereits 1125 hat der Orden seine eigene Ordensregel niedergeschrieben. Sie ist eine allgemeine Richtschnur für die Mitglieder, wobei sie aber keine genauen Regelungen für den Alltag festlegen möchte.
Die wichtigsten Pflichten im Orden sind das Bemühen um den christlichen Glauben, die Stärkung der Bruderschaft und das Einbringen der eigenen Kräfte und Fähigkeiten in die heutige Gesellschaft. 1964 wurde die Regel im aktuellen Sprachgebrauch neu verfasst. Das Grundstreben des Ordens ausdrückend, beginnt diese:
„Nach dem Vorbild und auf dem Weg der Väter des ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem will der Johanniter auch heute dem Herrn Jesus Christus dienen. Er lässt sich rufen, wo die Not des Nächsten auf seine tätige Liebe und der Unglaube der Angefochtenen auf das Zeugnis seines Glaubens warten.“
Balley Brandenburg
Europaweit organisiert verfügte der Orden über eine große Anzahl von Besitztümern. Um das Einflussgebiet besser verwalten zu können, wird er in Provinzen, sogenannte Balleyen, unterteilt. Eine Balley setzt sich dabei aus mehreren Kommenden bzw. Ordensniederlassungen zusammen.
Im deutschen Sprachraum wird die Balley Brandenburg ein wichtiger Teil der Ordensbesitzungen. 1382 schließen die Ordenszentrale und die Balley Brandenburg den „Heimbacher Vergleich“, der die Autonomie der Balley besiegelte.
Nach dem Übertritt des Markgrafen von Brandenburg zum Protestantismus folgten ihm die dort ansässigen Ritter der Balley und trennten sich 1539 geschlossen vom katholischen Gesamtorden. Dennoch wurden die bestehenden Zahlungsverpflichtungen an diesen weiterhin fortgeführt.
Heute führen die weiterhin katholischen „Johanniter“ den Namen Malteserorden, während die evangelische Balley den Namen Johanniterorden fortführt.
Im Zuge der Säkularisation wird das Vermögen des Ordens 1810 eingezogen und dieser aufgelöst. Das Geld diente der Begleichung der Reparationszahlungen gegenüber dem französischen Kaiserreich und der Finanzierung der späteren „Freiheitskriege“.
Ab 1812 wird der „Königliche Preußische St. Johanniterorden“ als Verdienstorden für ehrenvolle Dienste vergeben, was der ursprünglichen Ausrichtung des Johanniterordens nur noch bedingt entsprach.
Wiederbegründung der Johanniter
Erst 1852 erneuerte König Friedrich Wilhelm IV. v. Preußen (1795-1861), der sich sehr für kirchliche Fragen interessierte, den Johanniterorden in seiner jetzigen Form. Zum ersten Herrenmeister des wiedererweckten Ordens wurde der Bruder des Königs, Prinz Carl v. Preußen (1801-1883), ernannt.
Mit dieser Besetzung wurde eine lange Tradition fortgeführt. Seit 1693 bekleidete immer ein Mitglied der Familie Hohenzollern-Preußen dieses Amt. Derzeit ist bereits seit über 20 Jahren S.K.H. (Seine Königliche Hoheit) Dr. Oskar Prinz v. Preußen der Herrenmeister des Johanniterordens.
Konkretes Ziel des Ordens war die Errichtung und der Betrieb von Krankenhäusern sowie die Krankenpflege. Das erste Hospital konnte 1854 eröffnet werden. 50 Jahre später umfasste das Krankenhauswesen der Johanniter 52 Häuser mit etwa 3.000 Betten. Die Förderung des Protestantismus war dabei die allgemeine Aufgabe des Ordens.
Schnell nach der Wiedererrichtung des Ordens konnte die Balley Brandenburg auch das alte Ordensschloss Sonnenburg bei Küstrin wiedererwerben. Es wurde in den nächsten Jahren zum geistlichen Zentrum des Ordens ausgebaut. Gesellschaftlich hatte der Orden insbesondere im preußischen Einflussgebiet wieder stark an Ansehen gewonnen.
Etablierung und Bewährungsproben
Viele alte adlige protestantische Familien, deren Namen bis heute eng mit der deutschen Geschichte verbunden sind, finden sich in den Reihen des Ordens wieder und zeigen somit auch die enge Verbundenheit der Mitglieder zum königlichen und später kaiserlichen Haus Hohenzollern-Preußen. Nichtadligen war eine Mitgliedschaft im Orden jedoch lange Zeit vorenthalten.
In den von Preußen und seinen Verbündeten geführten Einigungskriegen 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870/71 gegen Frankreich linderten Johanniter, Ordensschwestern und freiwillige Helferinnen und Helfer das Leid auf den Schlachtfeldern und in Lazaretten. Auch waren Johanniter maßgeblich an der Organisation des Deutschen Roten Kreuzes beteiligt.
1886 wurde die Johanniter-Schwesternschaft als weiteres Ordenswerk gegründet. Während des Ersten Weltkriegs nahmen die Johanniter wieder eine wichtige Rolle in der Verwundetenversorgung ein und organisierten sogar mehrere Lazarettzüge, die den regelmäßigen Transport der Soldaten von der Front in die Heimat gewährleisteten.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Johanniter, aufgrund ihrer engen Bindung zur protestantischen Kirche und dem abgedankten Kaiserhaus sowie ihrer adligen Mitgliederstruktur, ein Dorn im Auge der neuen Machthaber. Zwar wurde der Orden nicht aufgelöst, aber das Tragen der Ordenszeichen und Neuaufnahmen in den Orden war strengstens verboten.
Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Orden und in der NSDAP war seit 1938 unvereinbar. Etwa 10 % der damaligen Mitglieder traten daraufhin aus dem Orden aus. Eine ganze Reihe von Johanniter- und Malteserrittern wurden im Zuge des gescheiterten Attentat- und Staatsstreichversuchs am 20. Juli 1944 hingerichtet.
Neuanfang
Nach 1945 verlor der Johanniterorden alle Besitzungen in den vormaligen Ostgebieten und in der sowjetischen Besatzungszone. Viele Mitglieder wurden im Krieg getötet oder waren wie die meisten Kriegsteilnehmenden an Körper und Geist verwundet. Die, die zuvor im Osten des Reiches beheimatet waren, wurden vertrieben und enteignet. Ab 1947 begann mit der Erlaubnis der Westalliierten der Wiederaufbau des Ordens und die Fortsetzung der diakonischen Arbeit in Westdeutschland.
Nach dem Willen des damaligen Herrenmeisters Oskar Prinz v. Preußen sollte für die Aufnahme in den Orden nicht mehr die adlige Abstammung ausschlaggebend sein, sondern die „ritterliche Gesinnung“. Erstmals seit dem Mittelalter konnten nun auch Nichtadlige wieder Johanniterritter werden. Die noch in der Obhut der Johanniter verbliebenen Krankenhäuser wurden wieder in Betrieb genommen und innerhalb kurzer Zeit erfolgte die Gründung neuer Ordenswerke
So entstand die erste Johanniter-Hilfsgemeinschaft bereits 1951, die Johanniter-Unfall-Hilfe folgte kurz darauf 1952. Die Werke sind, wie die Ritterschaft auch, an die Weisungen des Herrenmeisters gebunden. Die Aufsicht über die Ordenswerke und Einrichtungen erfolgt über die jeweiligen Genossenschaften bzw. Kommenden des Ordens, denen die Ritter zugeordnet sind und die jeweils durch einen Regierenden Kommendator geleitet werden.
Seit der Wiedervereinigung 1990 konnten die Johanniter auch in den neuen Bundesländern nach und nach Fuß fassen. Während in der Bonner Republik der Orden seinen Hauptsitz in Bad Pyrmont, Rolandseck und Bonn hatte, wurde er 2001 nach Berlin-Lichterfelde verlegt. Im gleichen Jahr folgte mit dem bundesweiten Zusammenschluss aller Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege zur Johanniter GmbH eine maßgebliche Reorganisation dieses Ordenswerkes.
Heute sind wieder über 4.000 Johanniterritter in 17 deutsche und fünf Genossenschaften bzw. Kommenden organisiert, die sich außerhalb der Grenzen Deutschlands in Finnland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Ungarn befinden. Allein die Johanniter-Unfall-Hilfe zählt als größtes Ordenswerk derzeit über 22.000 Beschäftigte, 37.000 ehrenamtliche Helfer und knapp 1,3 Millionen fördernde Mitglieder.